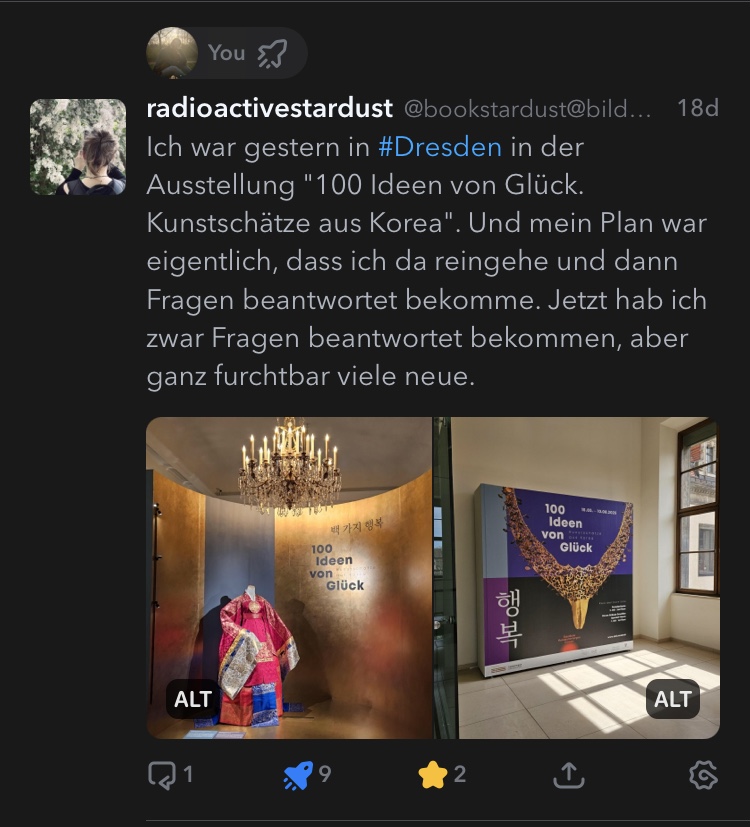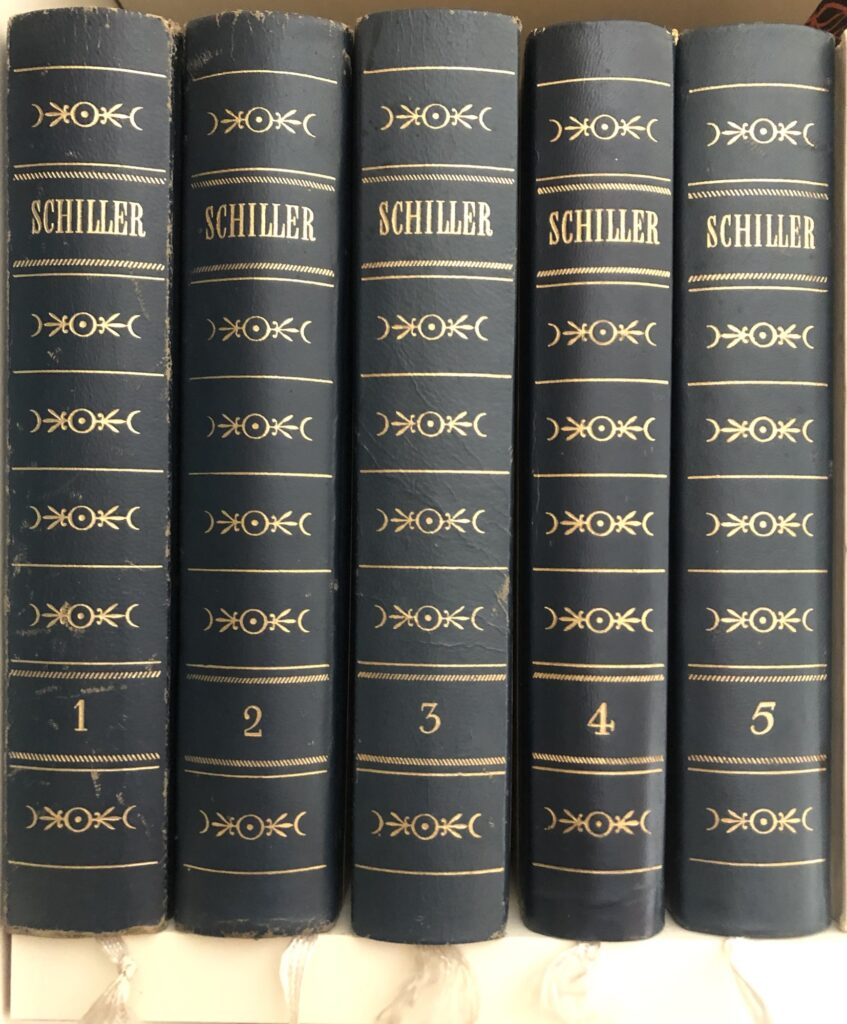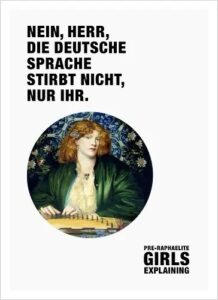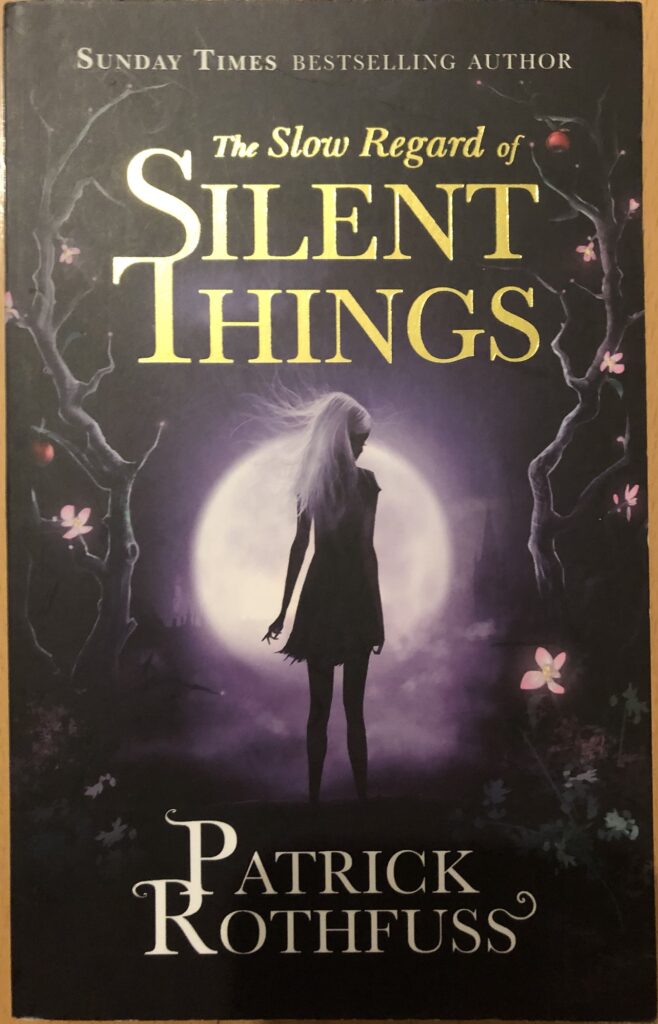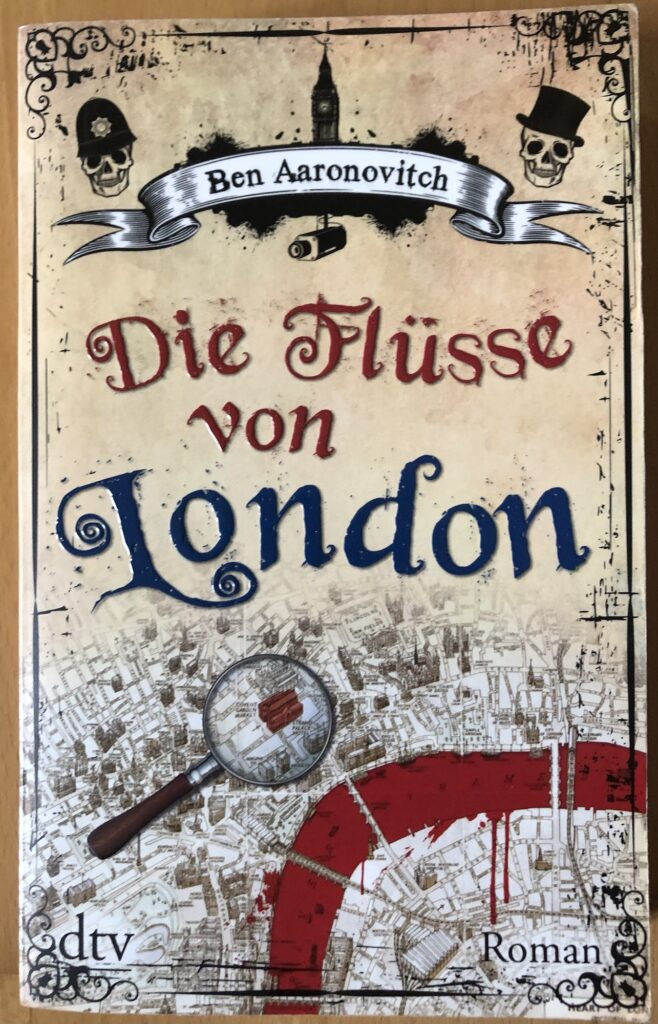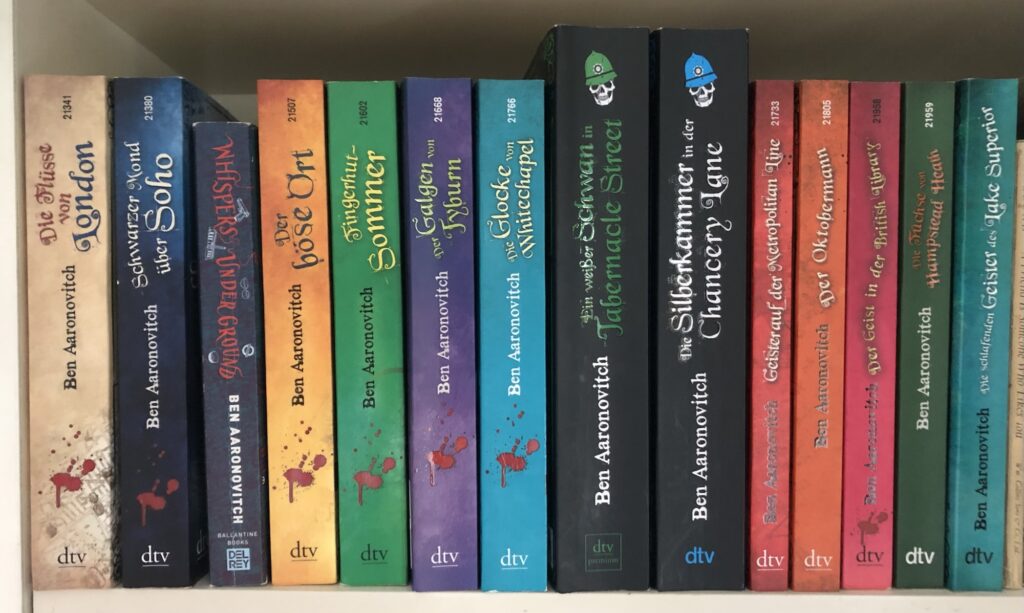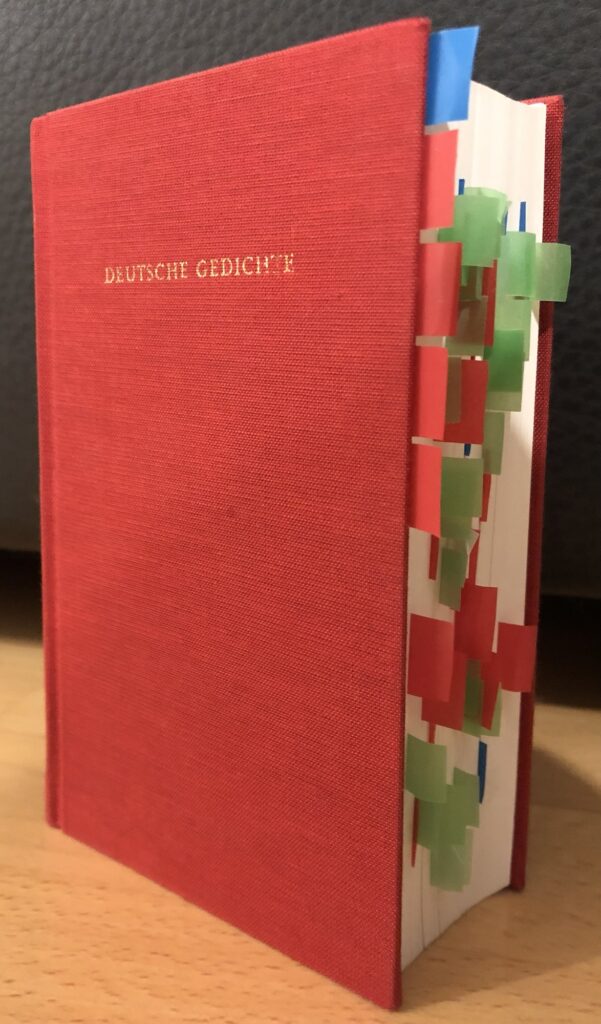Wenn @bookstardust auf Mastodon von der Ausstellung “100 Ideen von Glück” erzählt, für die das koreanische Nationalmuseum im Austausch für Leihgaben der Sächsischen Kunstsammlungen Ausstellungsstücke nach Dresden gegeben haben, dann springt da wohl schon mal ein sehr spontaner Kurzurlaub raus.
Wir sind also nach Dresden gefahren um die Ausstellung zu sehen. tl;dr: Es werden einige wirklich schöne Objekte gezeigt, aber Präsentation und Marketing lassen zu wünschen übrig. Am Ende stand ich mit mehr Fragen da als vorher.
Es fängt damit an, dass die Ausstellung unfassbar schlecht beworben ist – selbst in Dresden hängen quasi kaum Plakate dafür – UND in der Residenz noch schlechter ausgeschildert wird – es ist nicht deutlich in welchen Räumen die Objekte zu sehen sind und dass es in mehreren Etagen Ausstellungsräume gibt, habe ich auch erst spät verstanden. Am Ende habe ich mich gefragt, wie genau die Kooperation der Museen wohl ausgesehen hat. Wer hat die Texte geschrieben? Wer die Gestaltung gemacht? Wer war für die Beleuchtung zuständig? Warum wird die Ausstellung so stiefmütterlich behandelt? Gab es kein Budget?
Der größere Teil der Ausstellung befindet sich in den Paraderäumen der Residenz. In jedem Raum gibt es ein loses Überthema, allerdings wiederholen sich Aspekte. Die Ausstellung startet mit Hanboks, traditionellen koreanischen Kleidern. Das erste Objekt, mit dem Besuchende in der Ausstellung begrüßt werden, ist ein Zeremoniengewand der Königin. Der Ausstellungstext zu Füßen der Besuchenden verrät, wenn man sich die Mühe macht sich vor dem Kleidungsstück zu verneigen, um den Text zu lesen, dass es sich um ein Replikat handelt. Natürlich sind Textilien immer schwierige Objekte, die ganz besondere Anforderungen an Lagerung, Präsentation, Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit stellen, aber ich war ein bisschen war ich enttäuscht.


Auch die weiteren ausgestellten Kleider sind wirklich schön und ich habe viel Zeit im Ausstellungsraum verbracht – aber es sind alles moderne Stücke einer Designerin, die sich von historischen Modellen inspirieren ließ. Was völlig fehlt sind Informationen zur Bedeutung von Kleidung in der koreanischen Kultur. Warum eröffnet die Ausstellung ausgerechnet mit dieser Objektgruppe? Weil sie ein wichtiges Statussymbol waren? Wer trug und trägt solche Kleidung? Welche Bedeutung hat Kleidung in Korea heute (über den Trachteneffekt hinaus)? Selbst zur Geschichte des Hanboks erfährt man hier nur wenig, denn die historischen Kleidungsstücke fehlen. Ich verstehe, dass Textilien schwierige Leihgaben sind (siehe oben), aber ich hätte mir doch ein oder zwei historische Stücke gewünscht. Ebenfalls gewünscht hätte ich mir eine Hands-On Station, an der verschiedene verwendete Textilien angefasst werden dürfen – come on! ihr könnt mir nicht lauter Textilien mit spannender Struktur vor die Nase knallen und dann meinen haptischen Sinn nicht befriedigen!
Lasst mich kurz zu einem kuratorischen Thema abschweifen und uns über Ausstellungstexte reden: Deutlich zu viele Texte wurden auf Fußhöhe oder über Kopfhöhe präsentiert. (Für eine besucher*innenfreundliche Ausstelle wäre die Zahl der zu hohen oder zu tiefen Texte bei 0.) Die Kontraste waren teilweise nicht ausreichend, weiße Schrift auf mittelrotem Grund lässt grüßen. Für ähnliche Objekte wurde an mindestens einer Stelle die selbe Texttafel einfach zwei Mal in die unterschiedlichen Vitrinen gelegt. Und überhaupt sind die Ausstellungstexte – in der gesamten Ausstellung – sehr kurz, beziehen sich zumeist auf die Materialität oder benennen abgebildete Motive. Hintergründe zur Geschichte, zur Verwendung oder Entstehung der Objekte erfährt man dagegen nur sehr selten. Quasi an jeder Stelle hatte ich nach dem Lesen des Objekttextes mehr Fragen als vorher. Um bei der Kleidung (und speziell einem Hanbok von dem ich kein Bild gemacht habe) zu bleiben: Wie, wann und warum entstanden zum Beispiel die überlangen Überziehärmel, die zu manchen Hanboks gehörten? Wer trug sie? Warum greift man sie für ein modernes Kleidungsstück auf?



Es folgen Räume mit sehr alter Keramik, Bronze-Arbeiten und Porzellan. An irgendeiner Stelle behauptete ein Ausstellungstext, dass die koreanischen Objekte mit den Dresdner Ausstellungsräumen korrespondieren würden – aber spätestens im Thronsaal der Residenz war ich sehr enttäuscht, dass dem prunkvollen sächsischen Thron kein koreanisches Gegenstück gegenübergestellt wurde.

Besonders gefallen hat mir, dass die Herstellung von mehrfarbigem Porzellan durch Einritzen von Mustern, bedecken mit andersfarbigem Ton und Abkratzen der überflüssigen Schichten, erklärt wurde. Produktionsschritte von Gegenständen finde ich immer spannend. Allerdings war die zweite Hands-On-Station zum Prozess dann doch eher verwirrend, denn die gezeigten Reliefs stellten etwas völlig anderes dar, als auf der vorherigen Tafel mit Text und Bild beschrieben wurde. Eine Filmstation zum Thema Porzellanherstellung war so beliebig und schlecht geschnitten, dass ich es nicht ausgehalten habe länger davor zu stehen. Auch sonst fehlte mir hier wirklich Liebe zum Detail in der Präsentation. Wozu tolle Vasen so beleuchten, dass man sie auch sehen kann?

Apropos lieblose Ausstellungsgestaltung: irgendwie hätte ich mir 3D-Fotos statt der bloßen hochauflösenden Fotos auf den Medienstationen gewünscht, um die drei dimensionalen Objekte dann halt doch so richtig von allen Seiten sehen zu können.
Bevor wir zur meinem Lieblings-Hass-Moment in der misserfolgreichen Gestaltung eines Ausstellungsrundgangs kommen, möchte ich euch noch eine Objektgruppe zeigen, zu der ich mir erstens einen Gruppentext und zweitens ca. drei mal so viele Informationen gewünscht hätte.



Im vorletzten (sagte ich vorletzten?) Ausstellungsraum wurden unter anderem drei Uniformen präsentiert, die auf den ersten Blick fast identisch waren. Mit genauerem Hinsehen wurde dann deutlich, dass es viele kleine Unterschiede gibt. Wer Texte auf Fußhöhe lesen wollte, konnte erfahren, dass in zwei der Uniformen Metallplatten verbaut wurden, die andere also eine reine Uniform für den Hof war. Aber auch hier: So viele offene Fragen: Warum? Was ist mit den ganzen anderen unterschiedlichen Details? Wer? In welchem Kontext? Gibt es Geschichte(n) die hier erzählt werden könnten?
Den Abschluss des Rundgangs bildete ein Raum, in dem ein Objekt aus der völkerkundlichen Sammlung in Dresden. Der mehrteilige Raumschirm wurde in Kooperation mit koreanischen Restauratori*innen mühevoll restauriert. Und gibt der Ausstellung auch den Titel. (Hätte man mit dem Titel VIEL MEHR machen können? Zum Beispiel auch bei anderen Objekten erklären, was sie mit Ideen von Glück zu tun haben? 100 Objekte auswählen statt 180 – oder halt 100 Objekt-Cluster? Das Thema Glück thematisieren, das in Asien ja vielleicht eine ganz andere Bedeutung hat als in Europa? Ich schweife ab)

Mit diesem Objekt war für uns die Ausstellung zu Ende. Wir hatten Hunger und sind koreanisch Essen gegangen. Gab es ein Hinweis-Schild, dass die Ausstellung an anderer Stelle im Museum einen zweiten Teil hat? Nein. Hat das Museumspersonal mit dem wir an diversen Punkten über die Ausstellung gesprochen haben, darauf hingewiesen, dass es mehrere Ausstellungsteile gibt? Auch nein. Musste ich also nach dem Mittagessen zufällig heraufinden, dass im Neuen Grünen Gewölbe der Goldschmuck aus den Königsgräbern ausgestellt wurde? Ja. Bin ich immer noch ein bisschen pissig? Auch ja.
Eintritt: regulär 16€, mit Mitgliedsausweis des Deutschen Museumsbunds kostenlos
Öffnungszeiten: täglich 10—17 Uhr, Dienstag geschlossen, Freitag 10—19 Uhr
Laufzeit: 15.03.2025—10.08.2025
Museumsseite: https://gruenes-gewoelbe.skd.museum/ausstellungen/100-ideen-von-glueck-kunstschaetze-aus-korea/